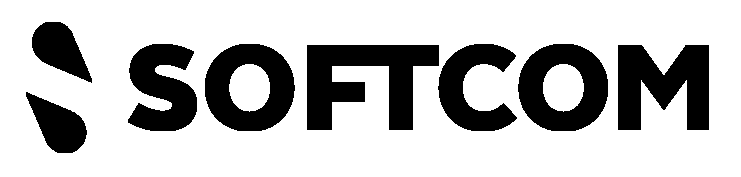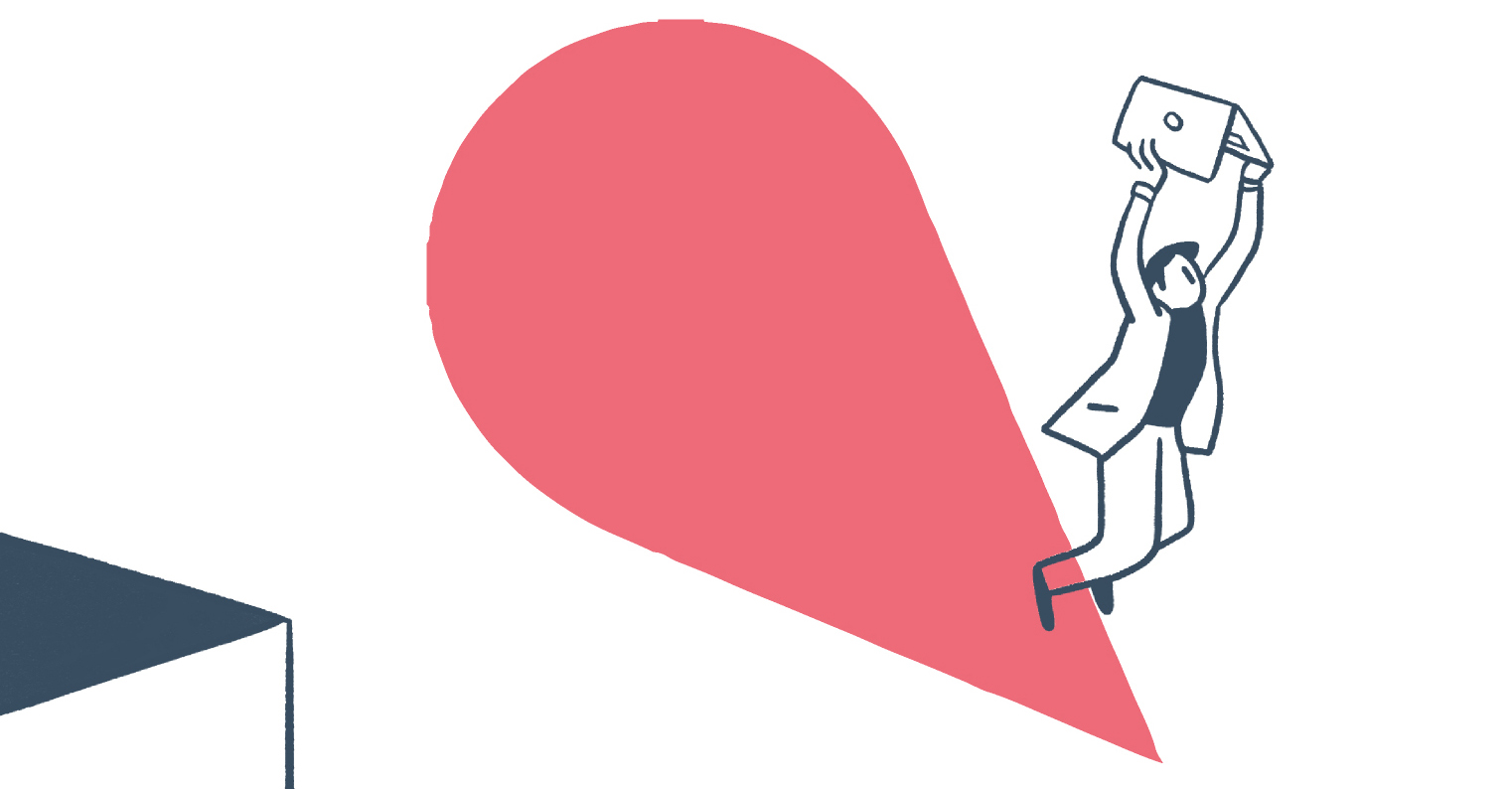Datenschutz, Garant für Demokratie
Jeder Fortschritt, jeder Vorstoss, jede Entwicklung, seien sie technischer Art oder nicht, hat seine Nachteile. Das gilt ebenso für die Emanzipation einer Datengesellschaft. Wo derzeit jeder und jede von uns 1,7 Megabyte pro Sekunde hervorbringen, wo digitale Daten derzeit immer mehr Dienstleistungen schaffen, verwerten und entwickeln, wo die Daten derart zentral geworden sind, ist ihr Schutz das Herz einer sozioökonomischen Diskussion von grosser Bedeutung. Und das umso mehr, als die Tendenz ziemlich eindeutig in Richtung eines drastischen Anstiegs der Datensammlung geht, insbesondere im Bereich des deep learning künstlicher Intelligenz, deren Datenhunger wohlbekannt ist.
Bereits 2013 ging der damalige Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte Hanspeter Thür wegen eines entscheidenden Themas auf die Barrikaden: Big Data. Den Aargauer beunruhigte bereits damals der exponentielle Anstieg privater Daten, die ungehindert im Netz zirkulierten und für kommerzielle Zwecke genutzt wurden. Er vertraute uns ohne Umschweife an, dass es «an der Zeit sei, die Situation zu klären. Viele kommerzielle Informationen zirkulieren frei im Internet. Man müsste jede Person fragen können, ob sie damit einverstanden ist, dass ihre personenbezogenen Daten sich im Netz verbreiten», bevor er hinzufügt: «Das erlaubt die gegenwärtige Gesetzeslage aber nicht. Das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) ist dieser Realität nicht mehr gewachsen.»
Sieben Jahre später ist die Lage praktisch unverändert. Tatsächlich stammt das Datenschutzgesetz aus dem Jahr 1992. Am 15. September 2017 stimmte der Bundesrat einer Überarbeitung zu, um es an die heutigen sozialen und technischen Bedingungen anzupassen und mit den neuesten und modernsten Regelung in Sachen Datenschutz anzupassen. Aber erst im September 2020 räumt das Schweizer Parlament die letzten Meinungsverschiedenheiten aus und verabschiedet das völlig überarbeitete Gesetz, damit es wahrscheinlich 2022 in Kraft treten kann. Was sieht es vor? Zunächst soll es «die Transparenz erhöhen und die Rechte Betroffener stärken; es fördert Präventivmassnahmen und persönliche Verantwortung der Nachunternehmen von Daten; es stärkt die Kontrolle des Datenschutzes; es sieht strafrechtliche Massnahmen vor», so die Bundesverwaltung.
Es geht also für die Schweiz darum, den Rückstand auf die europäischen Nachbarländer aufzuholen. Am 25. Mai 2018 trat in der Europäischen Union die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Diese Verordnung nimmt sich nicht weniger vor, als den Bürgern der EU in Sachen Datenschutz ihre Macht wiederzugeben. In den grossen Linien gewährt die DSGVO den Einzelpersonen mehr Rechte, wie etwa das Recht auf Vergessen und auf Datenübertragbarkeit. In anderen Worten, die Europäer können Auskunft darüber verlangen, welche Unternehmen ihre Daten in welchem Rahmen und zu welchem Zweck sammeln. Folglich können sie selbst entscheiden, welcher Plattform oder welchem Unternehmen sie ihre Daten übertragen.
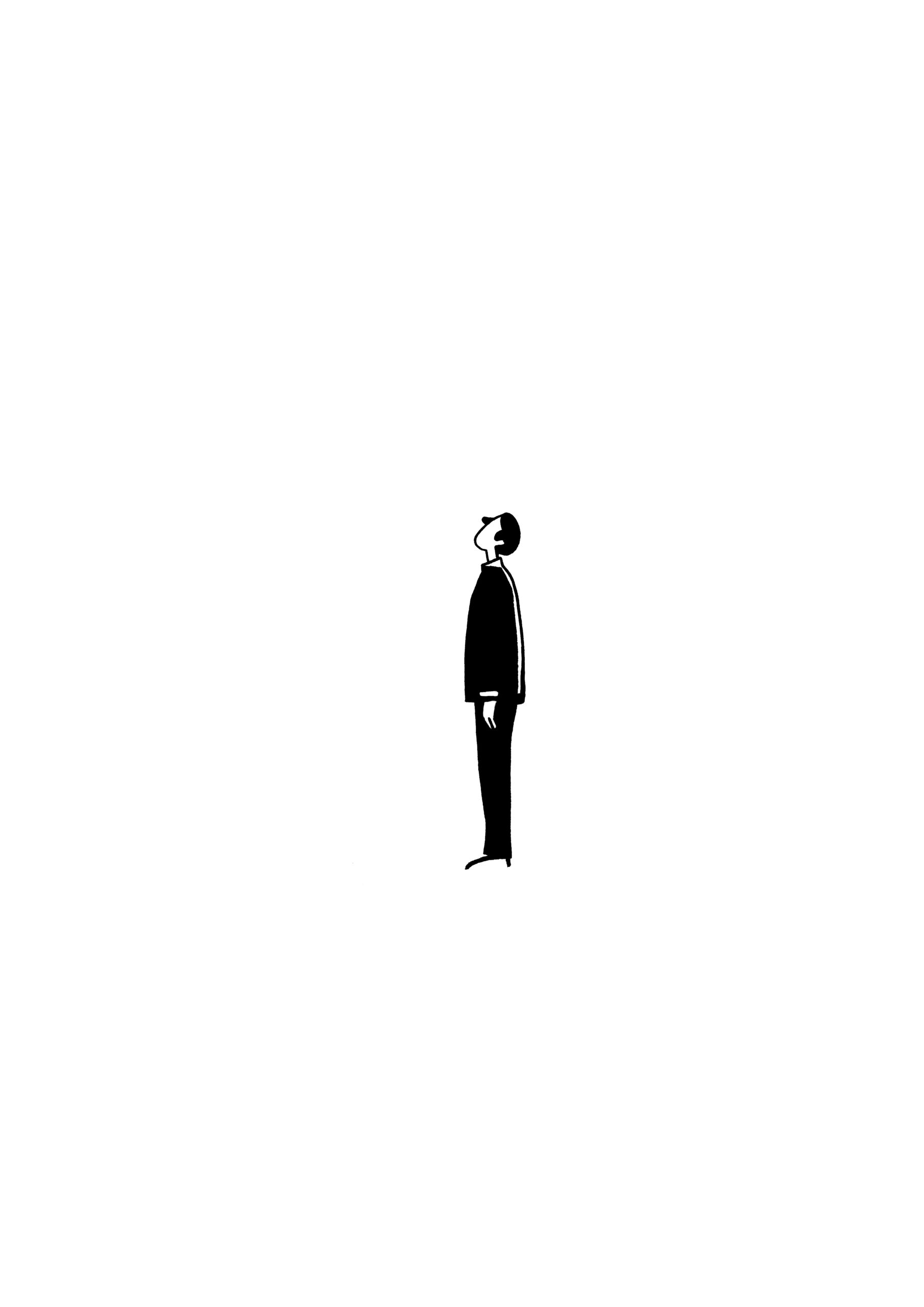
Nehmen wir das Beispiel einer Amazon-Kundin, die fortan online nur noch auf Zalando einkaufen möchte. Sie kann ihre Daten vom einer Plattform auf die andere übertragen lassen (Datenübertragbarkeit) und Amazon auffordern, ihre Daten zu löschen (Recht auf Vergessen). Wenn die Verordnung den Bürgern die Macht überträgt, so zwingt sie Unternehmen dazu, für eine aufgeklärte und informierte Zustimmung über die Datensammlung und -verarbeitung zu sorgen. Für Unternehmen ist es nicht leicht, sich darin zurechtzufinden. Vor allem Schweizer Unternehmen. Denn da die Verordnung in Europa gilt, betrifft sie auch die KMU sowie die multinationalen Schweizer Konzerne. Aber welche genau? Und in welchen Sektoren? Was ist unter personenbezogenen Daten überhaupt zu verstehen? Wie übersetzen sich diese legislativen Änderungen tatsächlich? Und welche Kosten entstehen mit der Übernahme der europäischen Datenschutzregeln?
Die Fragen der schweizerischen Unternehmen sind eng miteinander verschränkt und Teil der Ungewissheit über die Anpassung an die DSGVO. Aber keine Panik! Wir gehen die Dinge der Reihe nach durch. Ob ein Unternehmen davon betroffen ist, hängt von Kriterien ab, die, so der Lausanner Rechtsanwalt und Spezialist für Datenschutz sowie Informatik- und Technikrecht Sylvain Métille, «im Grunde sehr einfach sind. Nutzt das Unternehmen eine physische Niederlassung in der Europäischen Union? Und wenn dies nicht der Fall ist: Bietet es seine Güter und Dienstleistungen den Europäern an?». Dieses zweite Kriterium ist Gegenstand von Diskussionen.
Redaktion – Mehdi Atmani – Flypaper Media _ Illustration – Jérôme Viguet – Cartoonbase SÀRL